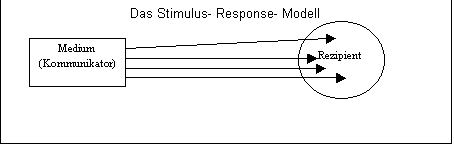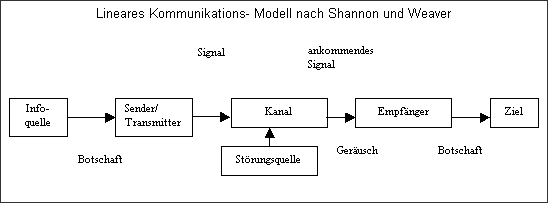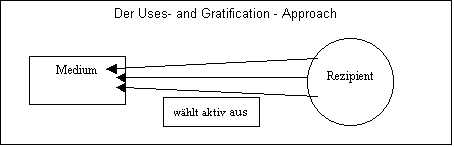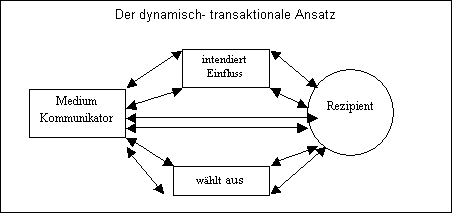|
zurück
zum Inhaltsverzeichnis |
|
Das dynamisch- transaktionale
Modell als methodische Grundlage
|
Übersicht |
|
|
2.2 |
Das Dynamisch-Transaktionale Modell als methodische Grundlage |
|
Das Stimulus- Response- Modell /SR-MODELL (Omnipotenzthese) |
|
|
Der Uses- and Gratification- Approach/ der |
|
|
Der dynamisch- transaktionale Ansatz |
|
|
2.2 |
DAS DYNAMISCH- TRANSAKTIONALE MODELL ALS METHODISCHE GRUNDLAGE |
|
Bei der Literaturanalyse wurde offensichtlich, dass Forscher bei der Beurteilung der Frage, ob sich der „Informationsgehalt“ von Fernsehprodukten messen läßt, bestimmte Annahmen über die Wirkung vom Fernsehinhalten zu Grunde legen. Dies taten beispielsweise die Forscher Shannon und Weaver, auf die im folgenden Abschnitt einzugehen ist. Ferner ist die Frage, nach welchen Mechanismen das Medium Fernsehen „wirkt“, auch wichtig für die Beurteilung der „Themenqualität“ des nachrichtlichen Filmberichtes. In diesem Zusammenhang greift die Arbeit zur Beurteilung der Qualität der Themenauswahl in Abschnitt 4.3 auf sogenannte Nachrichtenfaktoren zurück. Diese werden von den Forschern im Hinblick auf ihre „Wirkung“ diskutiert und einem bestimmten Medienwirkungsmodell zugeordnet, so zum Beispiel von Christiane Eilders (1997). Die Kommunikationswissenschaft kennt drei Medienwirkungsmodelle. Hierzu zählt das Stimulus- Response- Modell, der Uses- und Gratification- Ansatz sowie das dynamisch- transaktionale Modell. Eines der drei Modelle, nämlich das dynamisch- transaktionale Modell wird zur methodischen Grundlage dieser Arbeit erklärt. Die folgende Kurzpräsentation der einzelnen Modelle dient dazu, diese Entscheidung zu begründen. |
|
|
2.2.1 |
|
|
Der Sender einer Botschaft bewirkt mit seiner Botschaft bei den Empfängern die von ihm gewünschte Reaktion |
|
|
Auf dem SR- Modell basiert Shannons/Weavers Kommunikationsmodell, was jedoch nicht zur Messung der Informationsqualität geeignet ist |
|
|
Nach Jonscher (1995:438) war das Stimulus- Response- Modell (SR-Modell) bestimmend für die Anfänge der Medienwirkungsforschung, welches die Allmacht der Medien postuliert. Dabei geht das SR- Modell davon aus, dass ein bestimmter Kommunikationsinhalt, der Stimulus, jedes Individuum der Gesellschaft auf die gleiche Weise erreicht, wobei jedes Gesellschaftsmitglied die Kommunikationsinhalte (Stimuli) in der gleichen Art wahrnimmt. Dadurch wird als Ergebnis eine bei allen Individuen ähnliche oder gleichförmige Reaktion hervorgerufen. Es steht folglich in der Macht des Senders einer Botschaft (den Medien), bei den Empfängern des Medieninhaltes eine bestimmte Reaktion hervorzurufen, die mit der von ihm beabsichtigten Wirkung übereinstimmt. Weiterhin erklärt Merten (1994:295) die Herleitung des Namens „Stimulus- Response- Modell“: Es stammt als Kausalitätskonzept ursprünglich aus den Naturwissenschaften und wurde von der Psychologie aufgegriffen. Hier diente es zur Erklärung von bewussten oder unbewußten Reflexen im Sinne eines Reiz- Reaktions- Schemas. Der Stimulus entspricht dem Reiz, der auf einen Empfänger trifft. Dieser reagiert auf den Reiz mit einer Reaktion (Stimulus- Response). |
|
|
Das dynamisch- transaktionale
Modell als methodische Grundlage
|
|
|
|
|
|
Quelle: (Merten:1994:295) |
|
|
Diese
Omnipotenzthese der Medien schien in der Praxis auch so zu funktionieren, wie es
oben beschrieben wurde. So erfasste im Herbst 1938 die Zuhörer Panik, nachdem
sie im Radio Orson Welles Hörspiel „Invasion vom Mars“ gehört hatten.
Diese Verhaltensweise entsprach dem obigen Schaubild. Der Kommunikator zielt auf
den Rezipienten. Sofern er ihn trifft, kann er im Sinne Aristotelischer
Vorstellungen über sachgerechte Rhetorik eine Veränderung des Wissens, der
Einstellung und des Verhaltens bewirken. Nach
Jonscher (1995:438) bewirkte der Glauben, dass ein direkter Zusammenhang
zwischen den Medieninhalten und den Reaktionen der Empfänger besteht, mehrere
Konsequenzen. So forschte der amerikanische Politikwissenschaftler Harold Dwight
Lasswell über Probleme der Massenkommunikation, der Macht und über das
Verhalten von Eliten. Nach ihm ist die sogenannte „Lasswell- Formel“
benannt. Die zentrale Frage der „Lasswell-Formel“ aus dem Jahr 1948 lautet: Wer
sagt was zu wem durch welchen Kanal mit welcher Wirkung? Dabei suggeriert
diese Formel, dass Wirkungen automatisch erzielt werden, sobald die
verschiedenen Stufen des Massenkommunikations- Prozesses durchlaufen seien. Die
wichtigste Grundannahme der Lasswell- Formel ist wohl jene, welche den
Kommunikator als aktiven, den Rezipienten dagegen als passiven Part beim
Kommunikationsprozess versteht. Ferner unterstellte Lasswell mit seiner Formel
bei der Kommunikation drei weitere Bedingungen. Massenkommunikation betrifft
hauptsächlich Individuen. Sie geschieht absichtlich, wobei der Kommunikator
eine bestimmte Wirkung intendiert. Massenkommunikation geschieht episodisch.
Dabei sind die einzelnen Botschaften begrenzt, zeitlich isolierbar und besitzen
jeweils eine voneinander unabhängige Wirkung. Laut Jonscher (1995:438) führte diese Überzeugung unter anderem zur Entwicklung von Meßinstrumenten, da es wichtig zu sein schien, den Wirkungszusammenhang von Stimulus und Response präzise nachweisen zu können. Ein Beispiel dafür ist das lineare Kommunikationsmodell nach Shannon und Weaver (1969). Das von den beiden Wissenschaftlern entworfene mathematische Modell der Kommunikation beschreibt den Kommunikationsvorgang als eine lineare Anordnung von Elementen, die in einer Richtung eindeutig miteinander verbunden sind. Sender- und Empfängerseite werden hier jedoch differenzierter dargestellt.
|
|
|
Das dynamisch- transaktionale Modell als methodische Grundlage |
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: (Shannon/ Weaver:1969:7) |
|
|
Auf der Senderseite steht die Informationsquelle, von der eine Botschaft ausgeht (Shannon/Weaver:1969:7). Ein sogenannter Transmitter /Überträger kodiert die Botschaft zum Signal. Informationen definieren Shannon und Weaver nicht als das, was gesagt wird, sondern als Bedeutung, die gesagt werden könnte. Der semantische Sinngehalt ist folglich für Shannon und Weaver unerheblich. Die Information wird im mathematischen Informationsmodell als nachrichtentechnische Größe verstanden, wobei eines der Ziele des Modells die Messung des Informationsbetrages ist (Shannon/Weaver:1969:8). Auch wenn in dieser Arbeit ein ähnliches Ziel verfolgt wird, nämlich die Messung von Qualität, ist wohl das Modell von Shannon und Weaver als methodische Grundlage zur Messung der Informationsqualität nicht geeignet. Wie Hans J. Kleinsteuber (1999:Internet) wird hier die Ansicht vertreten, dass der semantische Informationsbegriff mehr als ein quantitativer Ausdruck für technisch ausgetauschte Daten ist. Zudem basiert das Messmodell von Shannon und Weaver auf dem Stimulus- Response- Modell, das heute als veraltet gilt. Denn Harold Dwight Lasswell ließ mit seiner Formel „Wer sagt was zu wem durch welchen Kanal mit welcher Wirkung?“ den Umstand außer Acht, dass die Massenkommunikation kein in sich abgeschlossener Prozess ist. So befinden sich beispielsweise die Zuschauer einer im Fernsehen gesendeten Talkshow in ganz verschiedenen sozialen Lebenssituationen, rezipieren die Sendung unter gänzlich verschiedenen Rezeptionsumständen und mit verschiedenen Erwartungen. Schon allein diese komplexen sozialen Faktoren verhindern die von den Vertretern des Stimulus- Response- Modells postulierte lineare Wirkung von Medieninhalten. Dass im Falle des Fernsehens die Zuschauer bei der Rezeption nicht passiv sind, sondern den Medieninhalt aktiv decodieren, demonstriert beispielsweise folgendes Zitat von Fiske:
|
|
|
„Pleasure for the subordinate is produced by the assertion of one´s social identity in resistance to, in independence of, or in negotiation with, the structure of donation.“ (Fiske:1987:19) |
|
|
Dem Zuschauer bleibt die Wahl, in welcher Art er den Fernsehtext lesen will. Dabei kann er sich unter anderem auch dafür entscheiden, den Inhalt einer Talkshow oder eines politischen Magazins entgegen der vom Kommunikator beabsichtigten Wirkung zu entschlüsseln, wobei er aus dieser Art der Decodierung sein Vergnügen zieht. Die eben angebrachten Argumente sollten für den Beweis genügen, dass das SR- Modell nicht wirklich geeignet ist, um Medienwirkungen zu erklären. Es kann daher auch nicht die methodische Grundlage dieser Arbeit sein. |
|
Das dynamisch- transaktionale
Modell als methodische Grundlage
|
2.2.2 |
Der Uses- and Gratification- Approach/ der |
|
Der Uses- and Gratification- Approach betont einseitig die Rolle des aktiv auswählenden Rezipienten |
|
|
Im Gegensatz zu dem Stimulus- und Responsemodell fragt der Uses- and Gratification- Approach: Was machen die Menschen mit den Medien? Dieser Ansatz wird dem von Fiske (1987:19) beschriebenen aktiven Verhalten der Rezipienten einer Medienbotschaft schon eher gerecht. Der Fernsehzuschauer decodiert den Medieninhalt und weist ihm aktiv eine Bedeutung zu. Diese Handlungsweise entspricht dem Uses- and Gratification- Approach, der im Rezipienten einen aktiven, zielstrebigen Medienkonsumenten sieht, welcher von den Massenmedien kommunikative Bedürfnisbefriedigung erwartet. Das impliziert, dass sich der Konsument zwecks Erfüllung seiner Bedürfnisse ein bestimmtes Medienangebot aussucht. Stellte das selektive Rezipientenverhalten beim SR-Modell noch eine Störgröße dar, so ist dies beim Uses- and Gratification- Approach nicht mehr der Fall. Die selektive Auswahl ist beim Nutzenansatz vielmehr eine Voraussetzung, damit ein Kommunikationsinhalt wirken kann. Dem Kommunikationsinhalt werden dabei von den Rezipienten Bedeutungen zugemessen, die Inhalte werden interpretiert und verwertet. [Vergleiche hierzu: (Jonscher:1995:447f.), (Merten:1994:317).] |
|
|
|
frei gestaltet nach: (Merten:1994:295) |
|
Das dynamisch- transaktionale Modell als methodische Grundlage |
|
Der Uses- and- Gratification- Approach entstand in den
siebziger Jahren als bewußte Abkehr vom Stimulus- Response- Modell und wurde
von Blumler und Katz entwickelt. Die ersten Forschungen im Sinne des Nutzen-
und Belohnungsansatzes wurden laut Merten (1994:317) bereits 1940 durchgeführt.
Untersucht wurden dabei die Motive, welche Hausfrauen dazu veranlassten,
„Seifenopern“ im Radio zu rezipieren. Die Forscher fanden heraus, dass die
Frauen diesen Medieninhalt gewählt hatten, um kurzzeitig dem Alltag zu
entfliehen (was mit Eskapismus bezeichnet wird), um sich mit den Personen zu
identifizieren, und um aus der Rezeption Ratschläge für die Verbesserung der
eigenen Lebenssituation zu ziehen. Jedoch geriet auch der Uses- and Gratification- Approach zunehmend in die Kritik. Er unterstellt nämlich den Rezipienten eine Souveränität bei der Auswahl der Kommunikationsinhalte, die, so meinen die Kritiker des Nutzen- und Belohnungs-Ansatzes, oftmals nicht gegeben ist. Kritikern dieses Ansatzes stellt sich nämlich die Frage, ob ein Fernsehzuschauer sich tatsächlich seiner Bedürfnisse bewusst ist, etwa wenn er durch die Fernsehprogramme „zappt“ (Jonscher:1995:448). Zudem betont der Uses- and Gratification- Approach ähnlich dem Stimulus- Resonse- Modell nur eine Seite im Kommunikationsprozess. War es beim SR- Modell der Kommunikator (die Medien), so ist es hier der (aktive) Rezipient. Damit kann auch der Nutzen- und Belohnungsansatz nicht als methodische Grundlage dieser Arbeit fungieren. Er wird jedoch nochmals bei der Diskussion der Unterhaltung thematisiert werden.
|
|
2.2.3 |
|
|
Dieser Ansatz interpretiert Massenkommunikation als Prozess der Wechselwirkung zwischen Rezipient und Kommunikator |
|
|
Der dynamisch- transaktionale Ansatz dient in dieser Arbeit als methodische Grundlage zur Erklärung von Medienwirkungen |
|
Der dynamisch- transaktionale Ansatz versucht die Einseitigkeit des SR-Modells sowie des Nutzenansatzes zu überwinden (Schönbach/Früh:1984:316). Er interpretiert Medienwirkungen als „multi- kausal“, als einen Prozess der Wechselwirkung zwischen den Interessen von Kommunikator und Rezipient (Jonscher:1995:448). Die Wirkung von Medien wird nach Schönbach und Früh (1984:316) sowohl von den Kommunikatoraussagen verursacht als auch von bereits im Rezipienten vorhandenen Erkenntnissen und spontanen Gemütsregungen. So wendet sich ein Rezipient einem Medium zu (zum Beispiel dem Fernsehen) und sucht dort, wie eben schon im Uses – und Gratification- Ansatz angesprochen, beispielsweise Rat oder Entspannung. Vielleicht ist er auch nur neugierig, was „im Fernsehen läuft“. Gelingt es den Fernsehproduzenten in dieser Situation ein Angebot zu senden, das vom Rezipienten als befriedigend empfunden wird, dann „trifft“ die entsprechende Information auf den Rezipienten und kann gemäß dem Stimulus- Response- Modell ihre Wirkung entfalten. |
|
Das dynamisch- transaktionale Modell als methodische Grundlage |
|
|
|
frei gestaltet nach: (Merten:1994:295) |
|
Kommunikator und Rezipient werden sowohl als passive wie auch als aktive Teilnehmer im Kommunikationsprozess gesehen, der von Schönbach und Früh (1984:314/315) als „Transaktion“ bezeichnet wird. Der Begriff Transaktion wurde zunächst für die Kommunikation zwischen zwei interagierenden Partnern verwendet. Schönbach und Früh übertragen diesen Begriff nun auf Prozesse, in denen solche wechselseitigen Beeinflussungen nur noch imaginär stattfinden. „Transaktion“ ist im Sinne der beiden Forscher kein kalkulierendes Aushandeln eines optimalen Kommunikationsnutzens zwischen Kommunikator und Rezipient, sondern ein Prozess, der gewohnheitsmäßig, unbewußt im Gefühlsbereich stattfindet. Im transaktionalen Modell beeinflussen sich Nutzung und Nutzen. So entstehen Effekte, die nicht mehr nur als Summe der Wirkungen von Medienaussagen und Motiv für die Nutzung in einer Art Feedback- Schleife darstellbar sein müssen. Dabei können diese Effekte einander verstärken oder auch abschwächen. Innerhalb eines Kommunikationsvorganges kann sich ein Zweck wandeln oder von einem anderen abgelöst werden. Darüber hinaus kann es mehrere bewusste oder unbewusste Ziele geben, die simultan Handlungen leisten. Schönbach/Früh (1984:314f.) unterscheiden beim transaktionalen Modell zwei Formen der Transaktion, die Inter- Transaktion und die Intra- Transaktion. Inter- Transaktionen sind imaginäre (Bücher, Zeitschriften) oder reale Interaktionsprozesse (Gespräche) zwischen den Kommunikatoren und Rezipienten, wobei beim Fernsehen der Interaktionsprozess mittels der Medienbotschaft geschieht. Basis und Produkt von Inter- Transaktionen sind das „Bild vom Rezipienten beim Kommunikator“, beziehungsweise das „Bild vom Kommunikator beim Rezipienten“. Nach Meinung Schönbachs und Frühs (1984:315) bedeuten intertransaktionale Prozesse – etwa beim persönlichen Gespräch – nur selten Chancengleichheit.
|
|
Das dynamisch- transaktionale Modell als methodische Grundlage |
|
Finden Inter- Transaktionen zwischen zwei Kommunikationspartnern statt, so zeichnen sich diese dadurch aus, dass sie innerhalb des Rezipienten stattfinden – und zwar zwischen seinem „Aktivationsniveau“ (Müdigkeit, Stress, etc.), seiner Aufmerksamkeit, seinem Interesse an einer Kommunikation, seinem Wissensstand und seinen Vorstellungen von sich und seiner Umwelt. Das transaktionale Modell wird innerhalb der Rezipientenforschung immer wieder thematisiert und dient der Forscherin Eilders (1997:82) als Erklärungsgrundlage bei der Wirkung von Nachrichtenfaktoren auf die Rezipienten. Das ist verständlich, kann doch mit Hilfe des transaktionalen Modelles bzw. der inter- und intratransaktionalen Prozesse erklärt werden, warum derselbe Stimulus (die Medienbotschaft) nicht bei allen Rezipienten in gleicher Weise „auf fruchtbaren Boden fällt“, indem er Aufmerksamkeit erregt, verstanden und im Gedächtnis gespeichert wird. Im Falle, dass zum Beispiel das Aktionsniveau des Rezipienten durch Müdigkeit oder Stress niedrig ist, hat der Stimulus deutlich geringere Chancen, in der vom Kommunikator beabsichtigten Weise zu wirken. Eilders vergleicht die Nachrichtenfaktoren mit Stimuli (Reizen), welche auf den Rezipienten einwirken. Mittels der von Schönbach und Früh beschriebenen inter- und intratransaktionalen Prozesse entschlüsselt der Rezipient nach Eilders´ (1997:88) Ansicht die Bedeutsamkeit eines Reizes für seine persönlichen Lebensumstände. Dabei trägt die Beschaffenheit des Stimulus dazu bei, dass der Rezipient ihn als bedeutsam (an)erkennt – oder auch nicht. Der gerade erklärte Vorgang entspricht der selektiven Aufmerksamkeit des Rezipienten, welche bei der Rezeption von Nachrichten von Bedeutung ist. So stellte der Nachrichtenforscher Ruhrmann (1994:245) bei seinen Rezipientenstudien fest, dass die Aufmerksamkeit für eine Nachricht unter anderem von der Bedeutsamkeit der Inhalte für den Rezipienten beeinflusst wird. Hier zeigt sich, dass die gerade erfolgte Diskussion auch für die Bewertung der Themenqualität relevant ist. Wenn Nachrichtenfaktoren mit Reizen vergleichbar sind, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann sollte ein „thematisch hochwertiger“ Filmbeitrag möglichst viele dieser für den Zuschauer „bedeutsamen“ Reize in sich vereinen. Die Diskussion um die Themenqualität auf der Grundlage des dynamisch- transaktionalen Modells findet sich daher in Abschnitt 4.3.
|
|
[1] Beachtenswert finde ich es in diesem Zusammenhang, dass es sowohl innerhalb der Cultural Studies als auch in der empirischen Kommunikationsforschung ähnliche methodische Ansätze gibt. Dabei verweise ich innerhalb der empirischen Kommunikationsforschung beispielsweise auf die inferentielle Inhaltsanalyse (vergleiche Atteslander:1995:240/241) oder die qualitativen Verfahren der teilnehmenden Beobachtung und des informellen Interviews. Ebenso arbeitete die Cultural Studies- Forscherin Ang „fachübergreifend“, indem sie für ihre Analyse der Beliebtheit der Fernsehserie „Dallas“ ähnlich einem empirisch arbeitenden Forscher 42 Briefe zur empirischen Grundlage ihrer Rezipientenstudie machte (Storey:1993:139). Anhand dieses Analysematerials untersuchte Ang die Mechanismen, welche beim Schauen der Serie das Vergnügen auslösten. Damit arbeitete Ang inhaltsanalytisch. |